Elisabeth Luise von Baiern -
eine Kulturphilosophin
Im zwischen 1841 und 1855 erbauten Neuen Museum, dem 2. in Berlin, bekam sie durch ihrem königlichen Gemahl Friedrich Wilhelm IV. von Preussen die Gelegenheit, ihre Vorstellungen als Wanddekorationen zu realisieren.
Das Gesamtkonzept beruhte auf dem Bestreben, ein großes Spektrum menschlicher Eigenarten und Verhaltensweisen mit den kulturellen Errungenschaften zu visualisieren. Dabei wurden die Ausdrucksweisen antiker Kulturen in Bildern auf Vasen, Münzen, Darstellungen der Bildhauer und Maler denen moderner Kulturen gegenübergestellt und inhaltlich fortgeführt. Es war von großem Vorteil, dass das Neue Museum die mit (zuächst) 600 Gipsabdrücken von großartigen antiken Werken bedeutende Gipsskulpturensammlung Preußens präsentieren sollte. Die Wandbilder führten zu den Geschichten, deren Höhepunkte eine Skulptur oder Skulpturengruppe zeigte.
------------------------------------------
König Friedrich Wilhelm von Preußen
und Elisabeth von Baiern
waren nicht nur die finanziellen,
sondern auch
die geistigen Stifter
des Neuen Museums in Berlin!
Das stand ab 1848
in Hieroglyphen verschlüsselt
auf den Säulen im Ägyptischen Hof !
Abbildungen, Text: ---> Kunst und Kultur ---> Architektur
---> Bildhauerei
---> Malerei
-----------------------------------------
Mehr darüber finden SIe in dem Sachbuch:
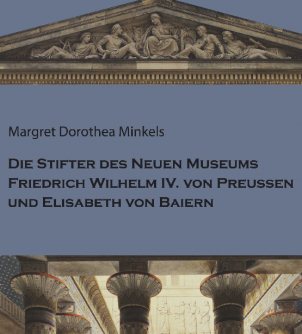
ISBN 978344802122, 640 Seiten, BoD Norderstedt, Ladenpreis 79,80 €
Dieses umfangreiche Sachbuch ist das erste und bislang einzige, in dem alle Wand-, Decken- und Fußbodendekorationen des Neuen Museums mit den ausgestellten Objekten nach den veröffentlichten Quellen des 19. Jahrhunderts zusammengestellt wurden.
DIm zwischen 1841 und 1855 erbauten zweiten öffentlichen Museum in Berlin wurde schon während seiner Bauzeit als das Neue Museum bezeichnet, um es von dem älteren zu unterscheiden. Diesen Namen hat es bis heute behalten; denn es war neuartig, da es die kulturellen Zusammenhänge der ausgestellten Objekte mit Hilfe der Raumdekorationen vermitteln wollte.
Das facettenreiche Gesamtkonzept des Neuen Museums vermittelt eine Wanderung von den Mythen und herausragenden Personen der Antike in Indien, Persien, Ägypten, Griechenland, Rom bis zu bahnbrechenden Erfindungen und den geistreichsten Zeitgenossen im 19. Jahrhundert. Durch Kriegsein- und nachwirkungen verloren gegangenes Wissen wird durch dieses Buch wieder zugänglich.
Die zahlreichen Text- und Bildquellen belegen, dass das komplexe Konzept für das Universal- und Lehrmuseum mit hoher Wahrscheinlichkeit von dem universell gebildeten Königspaar Friedrich Wilhelm IV. von Preussen und Elisabeth von Baiern entwickelt wurde.
Die 80 (davon 31 farbigen), Kapitel übergreifenden Bildtafeln im Anhang visualisieren die Erkenntnisse aus dem Textteil unter thematischen Schwerpunkten. Die Verknüpfung der Vorlagen, Entwürfe und Ausführungen im 19. Jahrhundert mit dem derzeitigen Erscheinungsbild des erst 2009 wieder eröffneten Museums erleichtert dem heutigen Museumsbesucher das Wiedererkennen der Räume.
---
Leseprobe:
Kapitel 4.9. Die Treppenhalle, das Zentrum der Kulturgeschichte (Seite 250) ...
4.9.2. Das kulturphilosophische Konzept für die Gestaltung der Treppenhalle (Seite 251)
In seinen Ausarbeitungen zur griechischen Geschichte beschrieb der Kronprinz die Taten des Perserkönigs Darius I. auf mehreren Seiten (-> Kap. 1.1.). Zusätzlich beeinflusst von dem griechischen Dramatiker Aischylos nahmen die Perserkönige, Darius I. /Dareios (549-486 v.Chr.) als ein Förderer der Künste und der Architektur, und Darius III. in der Gedankenwelt des preußischen Königs eine besondere Stellung ein. Friedrich Wilhelm imponierte die Idee des weisen Perserkönigs Darius I., die kulturellen Errungenschaften der antiken Kulturen darzustellen und in der Empfangshalle, die er in dem 515 v.Chr. gegründeten Persepolis bauen ließ, zu einer Neuschöpfung zu kombinieren. (Fußnote 1231)
In der Treppenhalle des Neuen Museums wollte das preußische Königspaar einen Überblick über die Höhepunkte der alten und neuen Kulturen geben und sie der neuen Zeit entsprechend mit alten und neuen Techniken umsetzen lassen. ... Nach Aristoteles machte es die besondere Befähigung des Menschen aus, sich für eine Haltung und die Entwicklung bestimmter, seinen Interessen naheliegender Fähigkeiten entscheiden zu können. In der Treppenhalle sollten Menschen in verschiedenen Kulturen vorgestellt werden, deren auf das Gemeinwohl und den Frieden ausgerichtete Denk- und Handlungsweisen den Grundprinzipien des Handelns des Königspaares ähnelten. ... Das Königspaar sah die Entwicklung der Kulturen als das wesentliche Thema eines Lehrmuseums als Schule der Nationen an. ...
------------------
Die Vier-Elemente-Lehre im Neuen Museum
An verschiedenen Stellen des Neuen Museums findet man Visualisierungen zur Schule der Stoa von Zenon und Seneca, die mit ca. 600 Jahren (von 300 v.Chr. - 300 n.Chr.) zu den langlebigsten Philosophenschulen zählt.
Von den 4 Elementen Erde, Wasser, Luft und Feuer steht letzteres der göttlichen Vernunft am nächsten.
Darstellungen zur Vier-Elemente-Lehre im Neuen Museum:
Treppenhalle:
Kinderfries (Kriegsverlust);
beschriftete Originalvorlagen im Kupferstichkabinett Berlin
Erde: Prometheus formt den ersten Menschen aus Lehm
Wasser: Geograph mit einem Senklot im Wasser, von Fischen umschwommen
Luft: Experiment mit energiegetriebenem Wurfgeschoss
Feuer: visualisiertes Sprachspiel: "Feuer unterm Hintern"
(detaillierte Beschreibungen im Buch "Die Stifter des Neuen Museums ... ", Kapitel 4.16.: Das rollende Rad des Schicksals im Kinderfries - im Kontext der Wandgemälde, S. 336-358; Abbildungen der genannten Figuren auf S. 633, Albumseite/As 75)
Vaterländischer Saal (EG): Wandbilder zu
Erdgeistern (beim Schiffsbau),
Wassergeistern (spielende Wasseralfen)
Luftgeistern (tanzende Elfen) und
der Feuerfürst Loki mit seiner Tochter Hel in der Unterwelt.
(detaillierte Beschreibungen im Buch "Die Stifter des Neuen Museums ... ", Kap. 4.25.: Die Edda im Vaterländischen Saal, S. 391-399; Abbildungen der genannten Figuren auf S. 619, Albumseite/As 61)
Griechischer Nordkuppelsaal (1. OG):
Abbildungen von Kindern mit Attributen
in Kassettenfeldern der Kuppel (nur noch Reste vorhanden)
Erde: Kinder mit Blütenkranz und Erntesichel, Hunden, Musikinstrumenten, Skulpturen
Kinder mit Delphin im Wasser
Kinder mit Tieren der Luft: Vögeln (Tauben, Papagei, Pfau)
Feuer: Knaben an einem Schmelztiegel und Amboß beim Schmieden von Waffen
(detaillierte Beschreibungen im Buch "Die Stifter des Neuen Museums ... ", Kap. 4.32.: Der griechische Nordkuppelsaal und die symbolträchtige Zahl Acht, S. 431-438; Abbildungen der genannten Figuren auf S. 615, Albumseite/As 57)
Kommentar eines Lesers zum Buch:
Das Konzept ist vermutlich ebenso einmalig wie die Nachweiskette, dass es von einem Königspaar stammt.
(M. H.)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leseprobe: zu Antigone
S. 48:
Die Zwillinge Amphion und Zethos aus Rhodos galten als Pendant zu den spartanischen Zwillingen Kastor und Polydeukes – und interessierten auch die weiblichen Zwillingspaare Elise und Amalie. Da Euripides Tragödie nur in Fragmenten erhalten war, bot sie sich an, um zu zeigen, dass die Prinzessinnen diese Literaturgattung beherrschten: Sie sollten nach griechischem Vorbild selbst ein Drama schreiben, das Antiope hieß. Es durfte aber keine Liebesgeschichte sein. Sie konnten die Lücken zwischen den Fragmenten mit ihrer Phantasie füllen. Antiope war nämlich auch eine Amazonenkönigin, die von Theseus, dem attischen Herakles, nach einem Kampf geehelicht wurde, um die Nordregionen Athens vor weiteren Überfällen zu schützen. Antiopes dritter Sohn war König Lajos von Theben, ihr Enkel Ödipus, der in Unkenntnis der biologischen Fakten seine eigene Mutter geheiratet hatte. Antigone erhob sich gegen die Anmaßung des Systems des – Tyrannis genannten – strengen Königtums, das der König von Theben ausübte. Obwohl der König bei Todesstrafe verboten hatte, den im Kampf gefallenen Polyneikes zu bestatten, stellte Antigone ihre Pflicht gegenüber den Göttern über die Pflicht gegenüber dem König; sie bestattete ihren Bruder. Zur Strafe wurde sie lebendig eingemauert und erhängte sich in ihrer Gruft. In der nach ihr benannten Tragödie hat Sophokles dem Gesang, der die Fähigkeiten des Menschen lobt, ein einprägsames Zitat vorangestellt: Staunliches waltet viel, doch nichts Erstaunlicheres als der Mensch. (Dieser Satz wurde später im N.M. als Zitat über die Tür zum Südportal gesetzt.)
S. 154:
Wie als Einstimmung auf die Höhepunkte des N.M.s wurden die Tragödien Antigone und Iphigenie auf Tauris der antiken Schriftsteller Sophokles und Aischylos als Aufträge des Königspaares schon während der Rohbauphase wieder auf die Berliner und Potsdamer Bühnen gebracht. Aischylos war von besonderer Bedeutung, da er einen entscheidenden Moment der Menschheitsgeschichte beschrieben hatte: Die Bildung eines Rechtsstaates, um das Zeitalter des Krieges und der Gewalt zu beenden. Mit der neuen Weltordnung begann eine neue Zeit.
S: 155:
Der König hat nicht nur Giacomo Meyerbeer als Generalmusikdirektor, sondern zusätzlich den begabten Felix Mendelsohn-Bartholdy als Kapellmeister engagiert. Letzterer war der Neffe des 1827 verstorbenen preußischen Gesandten Salomon Bartholdy, der die in Rom lebenden preußischen und bayerischen Künstler zu einem Hochzeitsalbum für das damalige Kronprinzenpaar angeregt hatte. Mendelsohn-Bartholdy wurde mit der Komposition einer passenden Musik zur griechischen Tragödie Antigone von Sophokles beauftragt. Es war ein Drama, das die Königin schon in ihrer Schulzeit beeindruckt hatte. Im Oktober 1840 fand die erste Aufführung statt. Die Oper Medea von Euripides wurde mit der Musik von Wilhelm Taubert 1843 aufgeführt. Das Unverständnis der Zeitgenossen für die tiefgründigen Aussagen der antiken Dichter und Dramatiker artikulierte ein Kritiker in einem Beitrag in der Vossischen Zeitung über den Intendanten Ludwig Tieck: Wird uns »Antigone« bessere Liebhaberinnen, wird uns »Medea« bessere tragische Mütter bringen? Bedürfen wir in einer Zeit, wo es der Schauspielkunst gerade an der Wahrheit der Natur und den unmittelbaren Affekteingebungen gebricht, jambenkundige Verssprecher und Verssprecherinnen? … Ist die Weltanschauung der antiken Tragödie eine erhebende für das Christentum, eine belehrende für den modernen Dichter, der ein ganz anderes Fatum zu schildern hat, als das blinde, hoffnungslose, starre antike? Werden Dichter, Schauspieler und Publikum sich durch solche aus der Luft gegriffene Mittel bessern, vervollkommnen, veredeln?
Zum Ausgleich erfolgte die Erstaufführung von Shakespeares Sommernachtstraum im Herbst 1843. Da das abgebrannte Opernhaus zu diesem Zeitpunkt noch nicht wieder aufgebaut war, geschah dies im Theater im Neuen Palais in Potsdam. Es bot nur 226 Zuschauern Platz. Die Töchter der Bettina von Arnim sahen das Königspaar darin als Oberon und Titania.
Die Kritik bezüglich antiker Tragödien in der Zeitung hatte scheinbar keinen Einfluss; denn 1845 wurde Odipus in Kolonos von Sophokles mit der Musik von Mendelsohn-Bartholdy aufgeführt. Die mit der passenden Musik hinterlegten Dramen aus der Antike beindruckten die gebildeten Berliner und ihre auswärtigen Gäste sehr. 782 Dennoch scheint die Kritik das Königspaar insofern beeinflusst zu haben, dass es daraus die Aufgabe ableitete, der Bevölkerung die antike Literatur im Neuen Museum pädagogisch geschickt, also scheibchenweise nahe zu bringen und mit anschaulichen, ästhetischen Mitteln zu erklären.
S. 444f.:
5. Wandbild: Es zeigt einen Enkel des Königs Kadmos von Theben, Ödipus, als Greis mit schneeweißem Vollbart und durch Altersfalten markant gewordenem Gesicht.2207 Die geschlossenen Augenlider verweisen darauf, dass er die Welt um sich herum nicht mehr sehen konnte. Er wollte dies nicht mehr, nachdem er erfahren hatte, dass er kurz nach der Geburt im Gebirge ausgesetzt worden, als junger Mann seinen leiblichen Vater König Lajos von Theben getötet und danach unwissentlich seine ihm unbekannte leibliche Mutter, die Königinwitwe Iocaste/Epicaste, geheiratet hatte.2208 Mit zwei goldenen Haarnadeln seiner erhängten Gemahlin/ Mutter hatte er sich selbst geblendet. Die Mitleid erregende Darstellung als Bettler entspricht einem Vers in Sophokles Tragödie König Ödipus: Im Abzugslied singt der das Volk von Theben repräsentierende Chor: … Seht wie des Unheils Woge / Diesen Mann hinweggespült. In der Schlußszene fragte der als König abgedankte Ödipus den für seinen unmündigen Sohn nun regierenden Schwager/Onkel Kreon: Kennt Du meinen letzten Willen?2209 … Führt mich fort aus diesem Lande! … Kreon: Laß die Kinder, geh hinein! Ödipus: Niemand wird sie
mir entreißen! Sophokles ging in der Tragödie nicht weiter auf die Sorgen des Ödipus um seine vier verwaisten Kinder/ Geschwister Eteokles, Polyneikes, Antigone und Ismene ein. Hier setzte eine von der Königin Elisabeth entworfene weiterführende Interpretation des antiken Stoffes ein, welche die drei Tragödien des Sophokles in sich barg: Die zuerst geschriebene Antigone, König Oidipus und Oidipus auf Kolonos.
In der gemalten Szene wird der einst als Befreier Thebens bewunderte König Ödipus halb nackt, nur in ein langes Tuch gehüllt wegen seiner Blindheit von seiner Tochter/Schwester Antigone geführt. Ihr Diadem und der blaugrüne Mantel über dem weißen Chiton machen sie als Königstochter kenntlich. Links hinter Ödipus sieht man einen Opferaltar mit einem Relief, das zwei Männer zeigt. Die erhobenen Arme des alten weisen auf den Moment kurz vor dem Schlag mit dem Pferdestachel auf Ödipus Kopf hin.2210 Das dem Lajos durch das Orakel vorhergesagte Schicksal erfüllte sich, als Ödipus den Mann tötete. Hinter dem Altar stehen drei junge Frauen in roten Gewändern, eine mit brennender Fackel und einer mit einer abwehrenden Geste in Richtung des Fliehenden. Es könnten die drei Schicksalsgöttinnen sein; denn Ödipus bezeichnete sich als Sohn der Schicksalsgöttin Tyche, der Lenkerin des Schicksals, die auch Glück bringen konnte.2211
Passend zu dem runden Wandbild von Kaselowski steht über dem Südportal ein Zitat, das aus Sophokles Tragödie Antigone stammt: Staunliches waltet viel und doch nichts Erstaunlicheres als der Mensch.2212 (As. 62 ҉) Das Zitat war einem Gesang vorangestellt, der die Fähigkeiten des Menschen lobte. Nachdem Ödipus seinen Weg in Richtung Theben fortgesetzt hatte, war er am Weg nach durch die gefährliche Sphinx mit deren Rätsel konfrontiert worden: „Was geht am Morgen auf zwei Beinen, am Abend auf drei?“ Da Ödipus „der Mensch“ geantwortet hatte, der im Alter eine Krücke als drittes Bein benutzt, wurde er mit einem Krückstock gemalt. Auf diese Geschichte wies auch die Sphinx als Begleitfigur an der Außensseite des Museums hin. (-> Kap. 4.43.) Nachdem das Rätsel gelöst und die Thebaner von dem menschenmordenden Mischwesen befreit waren, gaben sie dem klugen Ödipus die verwitwete Königin Iocaste zu Gemahlin. Laut Sophokles dichterischer Erfindung hatte Ödipus mit Iokaste schon vier Kinder gezeugt, als die Pest in Theben Opfer forderte. Der König befragte deshalb das Orakel von Delphi. So kam die Lösung der Geschichte in Gang, in deren Folge sich Königin Iocaste erhängte und König Ödipus sich mit ihren goldenen Haarnadeln blendete.
Fußnoten:
2201 Dem im benachbarten Griechischen Nordkuppelsaal dargestellten Sohn des Zeus mit Alkmene, Herkules, hatte die eifersüchtige Hera zwei Schlangen ins Kinderzimmer geschickt, als der erst 8 Monate alt war. Während sein Halbbruder schrie, erwürgte Herkules die beiden Schlangen mit seinen schon kraftvollen Händen.
2202 GStA PK, I. HA., Rep 137 II H, Nr. 22, Bl. 51, Contract der kgl. Baukommission mit Becker.
2203 Für Karl Becker wurde der Malauftrag ein Sprungbrett zur Karriere; denn seine späteren Ölgemälde wurden von dem Kunstsammler Raczynski gekauft und gelangten später mit dessen Sammlung in die Alte Nationalgalerie. Darmstaedter, Robert, Hase-Schmundt, Ulrike v.: Reclams Künstlerlexikon, Stuttgart 2002, S. 67: Becker, Karl, … Hauptvertreter der Historienmalerei des 19. Jh., malte in einem an die venezianische Malerei des 16. Jh. anknüpfenden historisierenden Stil. Werke: Juwelenhändler beim Senator, Berlin, Alte Nat. Gal., Dürer in Venedig, ebd. . Außer ihm und Eduard Biermann haben es keine anderen Maler im Neuen Museum in dieses Künstlerlexikon geschafft. Streckfuß, Adolf: 500 Jahre Berliner Geschichte. Vom Fischerdorf zur Weltstadt. Berlin 1900, S. 791.
2204 Aeschylos: Supplices 305.
2205 Gemäldegalerie Berlin, Gesamtverzeichnis 1996, S. 99, Kat. Nr. 463, Abb. Nr. 2842.
2206 Skulpturengruppe von F. E. Adam, 1754: Jupiter mit der in eine Kuh verwandelten Joe.
2207 BPH Rep 50 A 2, Nr. 1-38: Schriftstücke betr. den Jugendunterricht des Kronprinzen Friedrich Wilhelm. BPH Rep 50, A2, Nr. 31: Faits principaux de l´Histoire ancienne, unpaginiert, unter 1228 (v.Chr.): Oedipe est chassé du throne de Thebes. -> As. 60. Skizze mit Bauchlandung eines durch ein wehendes Tuch als Genie dargestellten Menschen. 1848 behauptete der König FW IV. im Zusammenhang mit den Ereignissen der Märzrevolution von sich selbst, er habe auch dem Bauch gelegen.
2208 König Lajos und Königin Iokaste hatten gegen den Willen des Apollon ein Kind gezeugt.
2209 Sophokles (Buschor, Ernst, Übersetzer): König Ödipus, Stuttgart 1972, Vers 1517.